
Kurz gefasst
Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Inhalte der Patientenleitlinie in aller Kürze zusammen.
KHK
Bei einer koronaren Herzkrankheit (KHK) sind die Blutgefäße, die das Herz versorgen, oft verengt. Wenn das Herz nicht mehr ausreichend Sauerstoff bekommt, können Beschwerden oder sogar Schäden am Herzen auftreten. In Deutschland gehört die KHK zu den "Volkskrankheiten". Bei etwa 7 von 100 Frauen und etwa 10 von 100 Männern in Deutschland wird im Laufe des Lebens eine KHK bekannt.
Risikofaktoren
Manche Umstände begünstigen das Entstehen einer KHK. Dazu gehören unter anderem:
-
Rauchen;
-
Bewegungsmangel;
-
Übergewicht (Adipositas);
-
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus);
-
Bluthochdruck (Hypertonie);
-
psychosoziale Belastung, zum Beispiel Stress oder Depression.
KHK erkennen
Nach einer ausführlichen Befragung und körperlichen Untersuchung schätzt Ihr Arzt ab, wie hoch das Risiko ist, dass Sie an einer KHK erkrankt sind. Bei deutlichen Hinweisen auf eine KHK empfiehlt die Expertengruppe in der Regel ein Elektrokardiogramm (EKG) und einen Herz-Ultraschall (Echokardiografie) in Ruhe – also ohne körperliche Belastung. Je nach persönlicher Situation und Erkrankungsrisiko können weitere Untersuchungsverfahren zum Einsatz kommen.
Anzeichen und Folgen
Bei einer KHK treten nicht immer und ständig Beschwerden auf. Im Verlauf kann es aber immer wieder zu unterschiedlich starken Beschwerden kommen. Besonders bei körperlicher Belastung können Schmerzen hinter dem Brustbein, Engegefühl in der Brust oder Luftnot auftreten.
Treten diese Beschwerden auch in Ruhephasen auf, dann besteht dringender Handlungsbedarf. Eine KHK kann lebensbedrohlich verlaufen. Folgen einer KHK können sein: Herzinfarkt, Herzschwäche, Herzrhythmus-Störungen und plötzlicher Herztod.
Behandlung
Heilen kann man die KHK nicht. Aber mit einer guten Behandlung können Betroffene eine ähnliche Lebensqualität haben wie Gesunde. Die Behandlung verfolgt zwei Ziele: Beschwerden lindern und gefährlichen Folgen wie Herzinfarkt vorbeugen. Das wichtigste ist ein gesunder Lebensstil, das heißt: angemessene Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und möglichst Verzicht auf Rauchen. Darüber hinaus lässt sich eine KHK mit Medikamenten allein, oder zusätzlich mit Stützröhrchen (Stents) oder einer Operation am Herzen (Bypass-Operation) behandeln. Auch wer Stents oder eine Operation erhält, nimmt regelmäßig Medikamente ein.
-
KHK – wenn sich die Herzgefäße verengen
Eine koronare Herzkrankheit (kurz: KHK) ist eine ernst zu nehmende Erkrankung. Bei ihr sind die Gefäße verengt, die das Herz mit Blut versorgen. Das führt zu Brustschmerzen (Angina pectoris), Engegefühl und Luftnot. Mit einer passenden Behandlung können Sie gut mit einer KHK leben.
-
KHK – Was Sie oder Ihre Angehörigen im Notfall tun können
Eine koronare Herzkrankheit (kurz: KHK) kann bedrohliche Folgen haben, etwa einen Herzinfarkt. Hier erfahren Sie, woran Sie einen Notfall erkennen und wie Sie bei plötzlichen Brustschmerzen, Brustenge und Atemnot am besten reagieren können, zum Beispiel Ihr Nitro-Spray einnehmen. Auch weitere Maßnahmen zur Ersten Hilfe, eine Herzdruckmassage (Reanimation) und ein Defibrillator werden erklärt.
-
KHK – Ernährung und Bewegung sind wichtig
Ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sind für eine gute Behandlung der KHK ebenso wichtig wie Medikamente. Dieses Infoblatt gibt Ihnen wissenschaftlich belegte Anregungen für Ihren Alltag mit KHK.
-
KHK – Langzeitbehandlung mit Statinen
Bei der KHK sind die Gefäße verengt, die das Herz versorgen. Statine senken die Blutfette und schützen dadurch die Gefäßwände, auch die vom Herzen. Dadurch können sie bei der KHK Krankheitsfolgen wie Herzinfarkte verhindern. Erklärt finden Sie das in dieser Entscheidungshilfe.
-
KHK – Mögliche Untersuchungen bei Verdacht
Ärztliche Befragung und Untersuchung werden bei Verdacht auf KHK empfohlen. Welche Untersuchungen noch hinzukommen können, erläutert dieses Patientenblatt.
-
KHK – Warum Rauchstopp hilft
Warum Rauchen so schädlich bei KHK ist und wo Sie Hilfe bekommen können, wenn Sie mit Rauchen aufhören wollen, erläutert dieses Infoblatt.
-
KHK – Gemeinsam entscheiden
Eine KHK ist eine dauerhafte Erkrankung. Im Verlauf sind immer wieder wichtige Entscheidungen zu treffen, welche Behandlung für Sie die geeignete ist. Lassen Sie sich hierbei gut von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt unterstützen.
-
KHK – Stents einsetzen bei einer Herzkatheter-Untersuchung?
Nutzen Sie diese Entscheidungshilfe vor der geplanten Untersuchung, um gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt zu entscheiden, ob Stents eingesetzt werden oder zunächst ausschließlich mit Medikamenten behandelt werden soll.
-
KHK – Verengte Herzkranzgefäße: Stent oder Bypass?
Bei Ihnen sollen verengte Herzkranzgefäße mithilfe von Stents offengehalten oder operativ "überbrückt" (Bypass) sollen. Nutzen Sie diese Entscheidungshilfe, um gemeinsam mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt zu entscheiden, welcher Eingriff für Sie der passende ist.
-
KHK – Brauche ich eine Herzkatheter-Untersuchung?
Die Untersuchung ist in bestimmten Fällen wichtig, um die weitere Behandlung zu planen. Sie ist aber nicht immer notwendig. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten in dieser Entscheidungshilfe vor. So können Sie absehen, ob die Untersuchung in Ihrer Situation Nutzen bringt.
- Für diese Information haben wir die Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Chronische KHK genutzt. Diese ist für Ärztinnen, Ärzte und andere medizinische Fachleute gedacht.
Hier finden Sie unsere Methodendokumente:
Spezielle Angebote für Menschen mit chronischer KHK finden Sie unter den folgenden Adressen:
Deutsche Herzstiftung e. V.
E-Mail: info@herzstiftung.de
Internet: www.herzstiftung.de/selbsthilfegruppen.html
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e. V.
Unter dieser Adresse erfahren Sie, welche Herzgruppen es in Ihrem Bundesland gibt:
E-Mail: info@dgpr.de
Internet: www.dgpr.de
Stiftung "Der herzkranke Diabetiker"
Stiftung in der Deutschen Diabetes-Stiftung
E-Mail: info@der-herzkranke-diabetiker.de
Internet: www.stiftung-dhd.de
Wo sich eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe befindet, können Sie auch bei der Nationalen Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) erfragen:
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
Otto-Suhr-Allee 115
10585 Berlin
Telefon: 030 31018960
Fax: 030 31018970
E-Mail: selbsthilfe@nakos.de
Internet: www.nakos.de

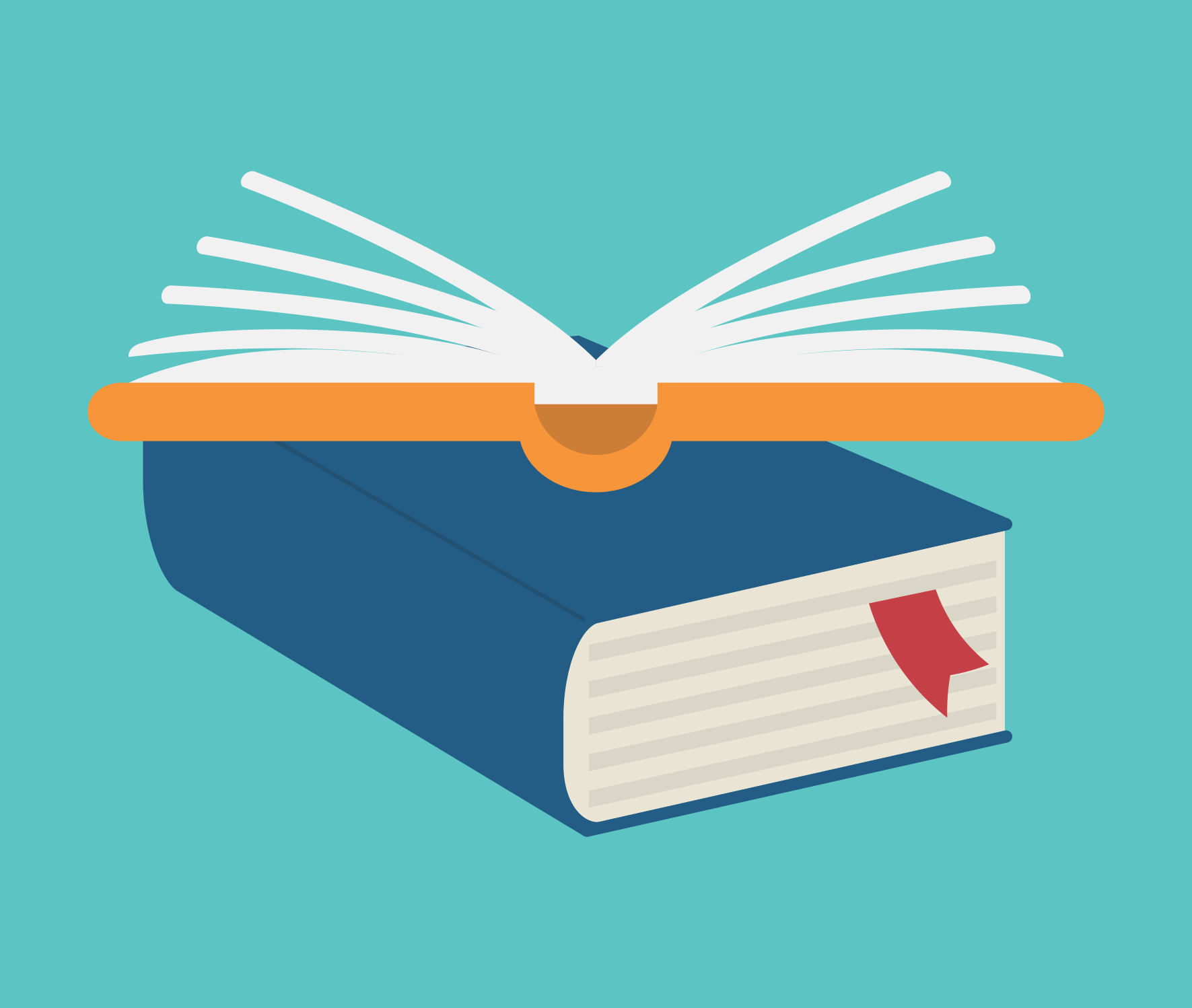

Hinweise und Kommentare
Sie haben Hinweise und Kommentare zu unserem Internetangebot?